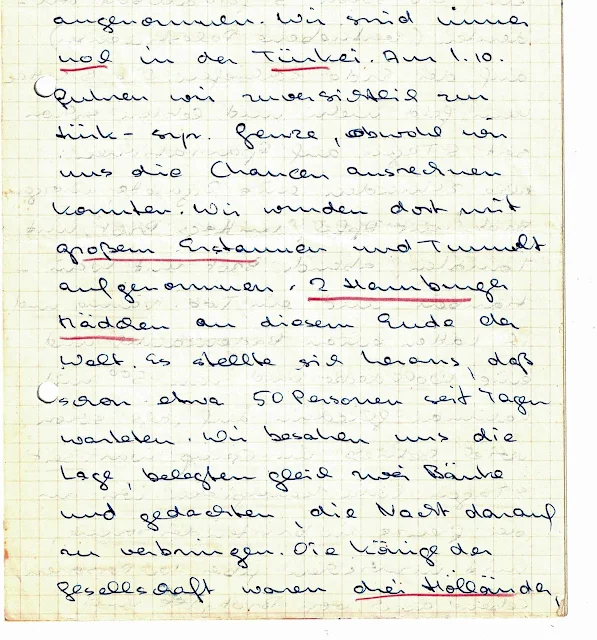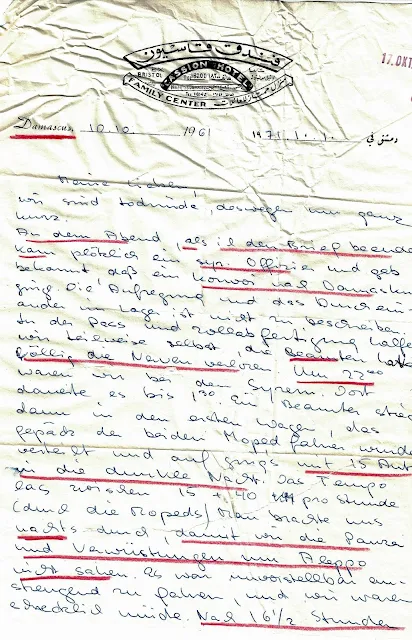Das ist
wohl so eine klassische Alterserscheinung. Irgendwann beginnt man sich über die
„Jugend von heute“ zu wundern und stellt bedeutungsschwangere Vergleiche an,
die letztlich darin münden der jungen Generation zu diagnostizieren es sich
leicht zu machen. Sie hätten es leichter und müssten weniger leisten. Früher
habe man sich mehr angestrengt und dennoch war „es“ früher alles besser. Zumindest
gesitteter.
Stefan
Zweig beschreibt in seiner „Welt von gestern“ (1942 – nach wie vor eins meiner
absoluten Lieblingsbücher!) eindrucksvoll den sittlichen und sexuellen Wandel,
der sich bei der Jugend der 30er Jahre verglichen mit Zweigs eigener Jugend zeigte.
Der aberwitzige Aufwand, der in gebildeten Schichten
Ende des 19. / Anfang des 20.
Jahrhunderts getrieben wurde, um sich angezogen zu baden, wird erstklassig in
Stefan Zweigs Meisterwerk „Die Welt von Gestern“ beschrieben.
Ich empfehle wärmstens das Kapitel „Eros Matutinos“
Als Karikaturen belachen auch die
naivsten Menschen von heute diese sonderbaren Gestalten von gestern - als
unnatürlich, unbequem, unhygienisch, unpraktisch kostümierte Narren; sogar uns,
die wir unsere Mütter und Tanten und Freundinnen in diesen absurden Roben noch
gekannt haben, die wir selbst in unserer Knabenzeit ebenso lächerlich gewandet
gingen, scheint es gespenstischer Traum, daß eine ganze Generation sich
widerspruchslos solch einer stupiden Tracht unterwerfen konnte. Schon die
Männermode der hohen steifen Kragen, der >Vatermörder<, die jede lockere
Bewegung unmöglich machten, der schwarzen schweifwedelnden Bratenröcke und der
an Ofenröhren erinnernden Zylinderhüte fordert zur Heiterkeit heraus, aber wie
erst die >Dame< von einst in ihrer mühseligen und gewaltsamen, ihrer in
jeder Einzelheit die Natur vergewaltigenden Aufmachung! In der Mitte des
Körpers wie eine Wespe abgeschnürt durch ein Korsett aus Fischbein, den
Unterkörper wiederum weit aufgebauscht zu einer riesigen Glocke, den Hals hoch
verschlossen bis an das Kinn, die Füße bedeckt bis hart an die Zehen, das Haar
mit unzähligen Löckchen und Schnecken und Flechten aufgetürmt unter einem
majestätisch schwankenden Hutungetüm, die Hände selbst im heißesten Sommer in Handschuhe
gestülpt, wirkt dies heute längst historische Wesen >Dame< trotz des
Parfüms, das seine Nähe umwölkte, trotz des Schmucks, mit dem es beladen war,
und der kostbarsten Spitzen, der Rüschen und Behänge als ein unseliges Wesen
von bedauernswerter Hilflosigkeit. Auf den ersten Blick wird man gewahr, daß
eine Frau, einmal in eine solche Toilette verpanzert wie ein Ritter in seine
Rüstung, nicht mehr frei, schwunghaft und grazil sich bewegen konnte, daß jede
Bewegung, jede Geste und in weiterer Auswirkung ihr ganzes Gehabe in solchem
Kostüm künstlich, unnatürlich, widernatürlich werden mußte. Schon die bloße
Aufmachung zur >Dame< - geschweige denn die gesellschaftliche Erziehung -
das Anziehen und Ausziehen dieser Roben bedeutete eine umständliche Prozedur,
die ohne fremde Hilfe gar nicht möglich war. Erst mußten hinten von der Taille
bis zum Hals unzählige Haken und Ösen zugemacht werden, das Korsett mit aller
Kraft der bedienenden Zofe zugezogen, das lange Haar - ich erinnere junge Leute
daran, daß vor dreißig Jahren außer ein paar Dutzend russischer Studentinnen
jede Frau Europas ihr Haar bis zu den Hüften entrollen konnte - von einer
täglich berufenen Friseuse mit einer Legion von Haarnadeln, Spangen und Kämmen
unter Zuhilfenahme von Brennschere und Lockenwicklern gekräuselt, gelegt,
gebürstet, gestrichen, getürmt werden, ehe man sie mit den Zwiebelschalen von
Unterröcken, Kamisolen, Jacken und Jäckchen so lange umbaute und gewandete, bis
der letzte Rest ihrer fraulichen und persönlichen Formen völlig verschwunden
war. Aber dieser Unsinn hatte seinen geheimen Sinn. Die Körperlinie einer Frau
sollte durch diese Manipulationen so völlig verheimlicht werden. […]
(Stefan Zweig 1942) (…..)
Natürlich
leide ich auch unter diesem Syndrom, runzele oft die Stirn, wenn ich an ihren
Smartphone klebende Teenager beobachte.
Früher
war aber doch nicht alles besser.
Trump
spricht von einem Allzeit-Hoch der US-Kriminalität und auch in Deutschland
scheinen andauernd Kinder sexuell missbraucht oder entführt zu werden.
Wahr ist
das aber nicht. Die Kriminalität auf Amerikas Straße sinkt seit den 1990er
Jahren kontinuierlich.
Durch
das Internet und die Boulevardmedien wird aber jeder einzelne Fall sofort
bekannt und breitgetreten, so daß der Eindruck entsteht es passiere viel mehr –
dabei wird nur mehr und schneller berichtet.
Im
SPIEGEL gibt es die Rubrik „Früher war alles schlechter“, in der scheinbare
aktuelle Verschlimmerungen aufgeklärt werden. Gerade erschien die 58. Folge.
Wie man
sich täuschen kann!
Ich
glaube, daß früher vieles anders war. Das kann man aber nicht so einfach in „positiv“
und negativ“ kategorisieren.
Natürlich
sind Smartphone und Internet eine enorme Erleichterung des Lebens.
Natürlich
grummele ich, wenn ich mitbekomme wie einfach Studenten von heute zu Hause mit
ein paar Klicks Informationen zusammentragen, für die ich während meines
Studiums Tage in der Bibliothek verbrachte.
Aber es
gibt auch eine Kehrseite, wie wir alle wissen inzwischen: 24/7 online bei den
sozialen Medien generiert gefährliche Informationsblasen, führt schon bei
Teenagern massenhaft zu Stress und Burnout. Nie wurden so viele Psychopharmaka
verschrieben.
Ich will
nicht mehr ohne Internet leben; trauere aber gleichzeitig den schönen Zeiten
ohne Internet hinterher.
Zum
Schluß noch ein Einblick in meine Familiengeschichte, der die besseren/schlechteren
früheren Zeiten vielleicht illustriert.
Meine
Mutter wanderte 1965 in die USA aus, lernte dort meinen Vater kennen.
Deswegen
bin ich Ami. Aber heute will ich kurz meine Vorfahren mütterlicherseits erwähnen.
Mein Opa wurde 1890 in Norddeutschland geboren. Er erbte von seinem Vater ein Geschäft, war also Kaufmann. 1912 bekam er seine erste Tochter; offensichtlich ungeplant – aber 1912 gab es eben weder Kondomautomaten an jeder Ecke, noch Antibabypillen.
Mein Opa wurde 1890 in Norddeutschland geboren. Er erbte von seinem Vater ein Geschäft, war also Kaufmann. 1912 bekam er seine erste Tochter; offensichtlich ungeplant – aber 1912 gab es eben weder Kondomautomaten an jeder Ecke, noch Antibabypillen.
Insgesamt
wurden es drei Söhne und drei Töchter, von denen meine Mutter, Jahrgang 1938,
die jüngste war.
Meine
Großeltern gehörten also zu der Generation, die das Pech hatten als Erwachsene
gleich zwei Weltkriege zu erleben. Beide von Deutschland angezettelten Kriege
bedeuteten für meinen Opa nicht nur den finanziellen Ruin, sondern auch einen
sehr persönlichen Verlust. Der älteste Bruder meiner Mutter starb als Kind kurz
nach dem WK-I, weil keine Medikamente zu bekommen waren und der Zweitälteste
starb im WK-II.
Zweimal
die komplette Existenzgrundlage zu verlieren kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Wieso dann überhaupt noch weitermachen?
Schon
als Kind, im ausgehenden 19-Jahrhundert wurde mein Opa zu Geschäftsreisen
(überwiegend nach Süddeutschland und ins Baltikum) mitgenommen. In den 20ern
und 30er Jahren nahm er die älteren Geschwister meiner Mutter mit, um ihnen zu
zeigen was es außerhalb Deutschlands gibt.
Sobald
es nach 1945 irgendwie ging, sparte sich mein Opa wieder einen VW-Käfer
zusammen, lud immer mindestens zwei seiner Kinder auf den Rücksitz und fuhr los
– nach Spanien, Italien, Frankreich.
Natürlich
waren diese Reisen ungleich beschwerlicher als heute. Ohne die entsprechenden
Autobahnen dauerten diese Fahrten mit dem kleinen Käfer ewig. Schicke
Hotelzimmer konnte sich mein Opa nicht leisten und Airbnb war bekanntlich noch
nicht erfunden.
Dafür
waren die iberischen Küsten aber auch noch nicht mit Bettenburgen zugeballert.
Man traf selten andere Touristen und wurde dafür umso herzlicher von den
Eingeborenen begrüßt.
Diese
Reisen machten einen so gewaltigen Eindruck auf meine Mutter und ihre
Geschwister, daß sie bis an ihr Lebensende davon erzählten.
Die
deutlich ältere Schwester meiner Mutter reiste in den 1950er Jahren als
Erwachsene lange nach Australien und in die USA, während ihr Bruder mit
Freunden in einem VW-Bus in Indien und Afrika unterwegs war.
Meine
Mutter, das Kriegskind wurde unterdessen in die Schweiz auf eine
Hauswirtschaftsschule geschickt. Erstens sollte sie Sprachen lernen und
zweitens war es für meinen Opa selbstverständlich, daß nur sein einzig verbliebener
Sohn eine höhere Schule besuchen sollte. Er erbte auch 100% des Geschäfts,
obwohl zwei seiner Geschwister älter waren. Aber die hatten keinen Penis und für
einen Mann des 19. Jahrhunderts stellte sich die Frage gar nicht, ob eine
Tochter auch Kaufmann sein könnte.
Bildung
und materielle Ressourcen erschienen meinem Opa offensichtlich als
Verschwendung für seine Töchter. Wenn sie später einmal reich sein wollten,
dann könnten sie ja reich heiraten, gab er ihnen als Ratschlag mit.
Ich bin heute
davon überzeugt, daß diese Einstellung meiner Großeltern keineswegs böse
gemeint war. Sie waren aber Produkte des 19. Jahrhunderts.
Da ging
man so mit Töchtern um.
Hier
also auch ein großer Unterschied zu heute: Meine Mutter hatte extrem minimierte
Startchancen. Die enorme Bildung, die sie sich später aneignete, passierte
autodidaktisch.
Was
blieb ihr auch anderes übrig; zum Entsetzen meines Opas heirateten gleich zwei
Töchter einen Künstler. Maler, also in den Augen meines Opas „brotlos“. Mit dem
Reichtum wurde es also nichts.
Nach der
Volksschule absolvierte meine Mutter eine Lehre. Mit 20 aber, schnappte sie
sich den immer noch existierenden VW-Käfer ihres Vaters und wollte endlich auch
wie ihre Geschwister allein, bzw mit einer Freundin reisen.
Ja, es
stimmt, die 50er und 60er Jahren in Deutschland waren ungeheuer spießig. Es
existiert eine anonyme Anzeige, die von der Polizei an meinen Opa
weitergeleitet wurde, in der sich ein Kunde beklagte, daß das Frl. (meine
Mutter) ein Rock trug, der nicht über die Knie reichte. Ihr Vater möge sie zur
Raison bringen.
Es waren
aber nicht alle Teens und Twens der Zeit Spießer. Im Gegenteil, es gab vielfach
Eskapismus.
Meine
Mutter guckte sich mit so gut wie keinem Geld in der Tasche die umliegenden
europäischen Länder an, um dann Anfang 1961 mit einer Schulfreundin mit
besagtem Käfer die Autoput hinunter zu fahren.
Ausführlich
bereiste sie Jugoslawien, die Türkei, Anatolien, Syrien, den Libanon, Jordanien,
Israel und Ägypten.
Mein Opa!
Daß Töchter studieren oder gar ein Geschäft führen könnten, kam ihm zwar nicht
in den Sinn, aber andererseits war er doch so liberal auch seine Jüngste für
fast ein Jahr im Nahen Osten zu verschwinden erlaubte.
Ich habe
meine Mutter oft gefragt, wie sie sich das leisten konnten, aber bis auf das
Benzingeld brauchten sie kaum etwas, weil sie als zwei junge weiße Mädchen
immer so auffielen, daß sie von irgendwelchen Einheimischen eingeladen wurden.
Die sprichwörtliche Gastfreundschaft des Orients.
Manchmal
konnten meine Großeltern etwas Geld schicken.
Dann
mietete sich meine Mutter ein Zimmer.
So zum
Beispiel im Oktober 1961 in Beirut, der damals schönsten Stadt der Welt.
So beschwerlich
das Reisen damals war, so einfach war es andererseits in anderen Aspekten –
Gastfreundlichkeit, Sicherheit, Unberührtheit.
Anderes
kommt mir heute auf schockierende Wiese vertraut vor.
Es war
nicht einfach für meine Mutter nach Syrien einzureisen.
Immer wieder
fuhr sie an die türkisch-syrische-Grenze, um es zu versuchen.
Als sie
schließlich in Damaskus angekommen war, schreibt sie nach Hause welche Mühe
sich die Syrer gemacht hatten, den Ausländern nicht das total zerstörte Aleppo
zu zeigen; es hatte sich noch nicht von Kriegen und Pogromen erholt.
Eins steht
fest, solche Reisen kann ich heute trotz Internet und Facebook und eines besseren
Autos nicht mehr machen. Schon gar nicht mit meinem US-Reisepass.
Früher
war alles besser.
Heute reisen
Jugendliche lieber All Inclusive. Per Billigflieger in Ferienfabriken.
Das ist
ungeheuer billig. Jeder reist jetzt. Es geht schnell und mühelos. Sprachen
braucht man nicht zu erlernen. Alles geht auf Deutsch. Man trifft überall auf
Deutsche, die sich zu Millionen ins Ausland begeben. Alles ist versichert, man
ist kontinuierlich in Kontakt mit Zuhause, verfügt über EC- und Kreditkarte.
Den
Schlafplatz spuckt das Klugtelefon aus und die Zimmer sind klimatisiert.
Die
Eltern müssen sich keine Sorgen machen, wenn die Kleinen in Lloret de Mar oder
auf Mallorca auf den Putz hauen.
Eigenartig,
trotz meiner Familiengeschichte, habe ich gar keine Lust mehr zu reisen.